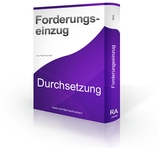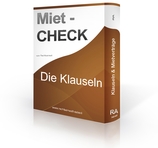Mietrecht - Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
BGH-Urteil vom 6. April 2005 - XII ZR 308/02
Geschäftsräume:
Endrenovierungsklausel
Summierungseffekt
Summierungseffekt
__________________________________
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
XII ZR 308/02
Verkündet am: 6. April 2005
Küpferle, Justizamtsinspektorin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
BGB § 536 a.F.; AGBG § 9 Bb, Cl
Wie im Wohnraummietrecht führt auch in Formularmietverträgen über Ge-
schäftsräume die Kombination einer Endrenovierungsklausel mit einer solchen
über turnusmäßig vorzunehmende Schönheitsreparaturen wegen des dabei
auftretenden Summierungseffekts zur Unwirksamkeit beider Klauseln (im An-
schluß an BGH, Urteile vom 14. Mai 2003 - VIII ZR 308/02 - NJW 2003, 2234,
2235; und vom 25. Juni 2003 - VIII ZR 335/02 - NZM 2003, 755).
BGH, Urteil vom 6. April 2005 - XII ZR 308/02 - OLG Saarbrücken LG Saarbrücken
Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 6. April 2005 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Hahne, die Richter
Sprick, Fuchs, Dr. Ahlt und die Richterin Dr. Vézina
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird unter Zurückweisung des
Rechtsmittels im übrigen das Urteil des 8. Zivilsenats des Saar-
ländischen Oberlandesgerichts vom 28. November 2002 teilweise
aufgehoben und insgesamt wie folgt neu gefaßt:
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts
Saarbrücken vom 20. November 2001 im Kostenpunkt und dahin
abgeändert, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verurteilt
werden, an die Klägerin 1.789,52 € nebst 4 % Zinsen hieraus seit
dem 9. Juli 1999 zu zahlen.
Die weitergehende Berufung der Klägerin wird zurückgewiesen.
Von den Kosten der ersten und zweiten Instanz tragen die Kläge-
rin 89 %, die Beklagten 11 %.
Von den Kosten des Revisionsverfahrens tragen die Klägerin
84 %, die Beklagten 16 %.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Parteien streiten darum, ob die Beklagten Schadensersatz wegen
nicht durchgeführter Schönheitsreparaturen, unvollständiger Räumung sowie
Beschädigung eines gewerblichen Mietobjektes zu leisten haben.
Die Klägerin war seit 1. August 1970 Pächterin eines Gaststättenobjektes
in W.. Sie unterverpachtete das Objekt (Restaurant samt Wirtewohnung) ab
1971 an die Beklagten. Das Rechtsverhältnis der Parteien bestimmt sich nach
dem Pachtvertrag vom 18. Januar 1979, mit dem ein früherer Pachtvertrag ab-
gelöst worden ist.
§ 7 des Pachtvertrages lautet:
"Pächter erkennt an, das Pachtobjekt in ordentlichem und gebrauchsfä-
higem/renoviertem Zustand erhalten zu haben.
Der Pächter hat das Pachtobjekt nebst Inventar pfleglich zu behandeln
und auf seine Kosten dauernd instand zu setzen. Er hat stets für ausrei-
chende Lüftung, Heizung und Reinigung aller ihm überlassenen Räume
zu sorgen.
Die Instandhaltung umfaßt alle Erhaltungsarbeiten und die sogenannten
Schönheitsreparaturen. Die Schönheitsreparaturen sind vom Pächter
ohne Aufforderung in angemessenen Abständen mindestens alle zwei
Jahre (Toiletten und Küche jährlich) sachgemäß und fachgerecht ausfüh-
ren zu lassen. Die Verpächterin ist berechtigt, den Pächter zur sachge-
mäßen Durchführung dieser Arbeiten anzuhalten und nach ergebnislo-
sem Ablauf einer angemessenen Frist die erforderlichen Arbeiten auf
Kosten des Pächters vornehmen zu lassen."
In § 17 des Vertrages heißt es:
"Bei Auszug hat der Pächter das Pachtobjekt vollständig geräumt und in
a) renoviertem und besenreinem
…
Zustand mit sämtlichen Schlüsseln zurückzugeben.
…"
Sowohl das Haupt- als auch das Unterpachtverhältnis endeten aufgrund
eines Räumungsvergleichs der Parteien mit den Hauseigentümern. Die Beklag-
ten zogen am 8. Januar 1999 aus, ohne Schönheitsreparaturen durchzuführen.
Das Landgericht hat die Klage der Unterverpächterin auf Ersatz der Ko-
sten für die Durchführung von Schönheitsreparaturen, die vollständige Räu-
mung und die Beseitigung von Schäden abgewiesen. Das Berufungsgericht hat
die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung von 11.317,53 € nebst Zinsen
verurteilt. Dagegen wenden sich die Beklagten mit der vom Oberlandesgericht
zugelassenen Revision.
Entscheidungsgründe:
Das Rechtsmittel hat überwiegend Erfolg.
I.
Das Oberlandesgericht hat ausgeführt, auf die schuldrechtlichen Pflich-
ten der Parteien seien die bis 31. Dezember 2001 geltenden Vorschriften des
BGB anzuwenden. Die Beklagten seien ihrer Verpflichtung zur Durchführung
der Schönheitsreparaturen nicht nachgekommen. Nach §§ 17 a, 7 Abs. 3 des
Mietvertrages seien sie zur Ausführung von Schönheitsreparaturen bei Ver-
tragsende unabhängig vom Zeitpunkt der letzten Schönheitsreparaturen ver-
pflichtet. Zwar sei auf den Vertrag das AGBG anwendbar. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs stelle die von § 536 BGB abweichende formu-
larmäßige Abwälzung der turnusmäßigen Schönheitsreparaturen auf den Mieter
grundsätzlich keine unangemessene Benachteiligung des Mieters im Sinne von
§ 9 Abs. 1 AGBG dar. Eine andere Beurteilung gelte auch nicht für die Rege-
lung des § 17 a des Pachtvertrages, wonach die Pächter verpflichtet seien, un-
abhängig von der Durchführung der letzten Schönheitsreparatur die Räume in
renoviertem Zustand zurückzugeben, ihnen also unabhängig von dem Grund
der durch sie erfolgten Abnutzung eine Endrenovierungspflicht auferlegt werde.
Für die Wohnraummiete sei zwar anerkannt, daß eine solche Klausel den Mie-
ter unangemessen benachteilige und deshalb gemäß § 9 AGBG unwirksam sei.
Das werde damit begründet, daß die Übernahme der laufenden Schönheitsre-
paraturen einen Teil des Entgelts für die Gebrauchsüberlassung darstelle und
damit letztlich auch dem Mieter zugute komme, der die Gebrauchsspuren be-
seitige und damit die renovierte Wohnung wieder nutzen könne. Dagegen
komme eine Endrenovierung, die die durchgeführten laufenden Schönheitsre-
paraturen unberücksichtigt lasse, allein dem Vermieter zugute, der entgegen
dem Leitbild der §§ 536, 548 BGB eine Wohnung erhalte, die gerade keine auf
den vertragsgemäßen Gebrauch zurückgehenden Abnutzungserscheinungen
mehr aufweise. Eine solche vom gesetzlichen Leitbild abweichende Regelung
sei gemäß § 9 AGBG unwirksam.
Bei Geschäftsraummietverträgen gelte diese Argumentation aber nicht.
Hier handele es sich in der Regel um geschäftserfahrene Mieter, die nicht so
schutzbedürftig wie ein Wohnraummieter seien. Deshalb sehe das BGB für
Wohnraummietverträge besondere Schutzvorschriften vor. So sei der Kündi-
gungsschutz stärker ausgeprägt als bei gewerblicher Miete. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs benachteilige in einem Wohnraummietver-
trag eine Formularklausel, die eine monatlich im voraus zu zahlende Miete vor-
sehe, bei einem Zusammentreffen mit einer die Aufrechnung mit Gegenforde-
rungen beschränkenden Klausel den Mieter unangemessen, weil er im Falle
eines zur Minderung berechtigenden Mangels im Folgemonat mit dem ihm zu-
stehenden Bereicherungsanspruch wegen Überzahlung der Miete nicht auf-
rechnen könne. In gewerblichen Pachtverträgen halte der Bundesgerichtshof
diese Beschränkung für zulässig. Nach der Rechtsprechung des Oberlandesge-
richts München stelle in gewerblichen Mietverträgen eine formularmäßige Ab-
wälzung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter anders als bei der Wohn-
raummiete auch dann keine unangemessene Benachteiligung dar, wenn der
Mieter die Räume in abgenutztem Zustand übernommen habe. Daraus folge,
daß jedenfalls bei Geschäftsraummiete größere Einschränkungen des Mie-
ters/Pächters durch AGB hingenommen würden. Deshalb sei die Endrenovie-
rungsklausel für den Mieter/Pächter von Gewerberäumen nicht unangemessen.
Der Schadensersatzanspruch der Klägerin wegen nicht durchgeführter Schön-
heitsreparaturen einschließlich eines dadurch bedingten Nutzungsausfalles
betrage 11.526,33 €.
Daneben stehe der Klägerin ein Schadensersatzanspruch wegen Be-
schädigung des Holzfußbodens in Höhe von 2.400 DM (= 1.227,10 €) sowie ein
Anspruch auf Ersatz der Kosten für die Entfernung eines Bretterverschlages
samt Sperrmüll in Höhe von 1.100 DM (= 562,42 €) zu. Nach Verrechnung mit
dem Kautionsguthaben in Höhe von 3.908,38 DM betrage die Forderung der
Klägerin 22.135,16 DM (= 11.317,53 €).
2. Die Auffassung des Oberlandesgerichts ist nicht frei von Rechtsirrtum.
Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß auf die In-
haltskontrolle der Formularklauseln § 9 AGBG anzuwenden ist, weil das Miet-
verhältnis vor dem 1. Januar 2002 beendet worden ist (vgl. Art. 229 § 5
EGBGB).
a) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung wurden die Klau-
seln nicht dadurch zu Individualvereinbarungen, daß die Parteien den Mietver-
trag durch Individualvertrag verlängert haben.
b) In der Rechtsprechung zur Wohnraummiete wird seit langem die Auf-
fassung vertreten, daß eine Regelung in einem Formularvertrag, die den Mieter
verpflichtet, die Mieträume unabhängig vom Zeitpunkt der Vornahme der letzten
Schönheitsreparaturen bei Vertragsende renoviert zu übergeben, wegen unan-
gemessener Benachteiligung des Mieters nach § 9 AGBG (jetzt: § 307 BGB)
unwirksam ist (OLG Hamm ZMR 1981, 179; OLG Frankfurt WuM 1981, 272).
Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich dieser Rechtsprechung
angeschlossen (Urteil vom 3. Juni 1998 - VIII ZR 317/97 - NJW 1998, 3114,
3115) und darüber hinaus entschieden, daß im Wohnraummietrecht auch je-
weils für sich unbedenkliche Klauseln einen Summierungseffekt haben und in
ihrer Gesamtheit zu einer unangemessenen Benachteiligung des Vertragspart-
ners des Verwenders führen können. Er hält in solchen Fällen sowohl die End-
renovierungsklausel als auch die Klausel, die die Übertragung der Schönheits-
reparaturen auf den Mieter regelt, für unwirksam (Urteil vom 14. Mai 2003
- VIII ZR 308/02 - NJW 2003, 2234, 2235; Urteil vom 25. Juni 2003 - VIII ZR
335/02 - NZM 2003, 755).
Ob diese Auffassung auf Mietverträge über Geschäftsräume übertragen
werden kann, ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten. Die überwiegende
Auffassung bejaht dies (OLG Hamm ZMR 2002, 822, 823; LG Hamburg WuM
1994, 675, 676; Scheuer in Bub/Treier Handbuch der Geschäfts- und Wohn-
raummiete 3. Aufl. V A 207; Herrlein/Kandelhard/Knops Mietrecht 2. Aufl. § 535
Rdn. 54; Hansen in Ulmer/Brandner AGBG 9. Aufl. Anh. §§ 9-11 Rdn. 509;
Schmidt-Futterer/Langenberg Mietrecht 8. Aufl. § 538 Rdn. 128 wollen danach
differenzieren, ob die Räumlichkeiten dem Mieter renoviert oder unrenoviert
überlassen worden sind). Eine Mindermeinung, der sich das Berufungsgericht
angeschlossen hat, ist der Auffassung, daß der Geschäftsraummieter nicht wie
ein Wohnraummieter sozial schutzbedürftig sei (OLG Celle NZM 2003, 599;
Wolf/Eckert/Ball Handbuch des gewerblichen Miet-, Pacht-, und Leasingrechts
9. Aufl. Rdn. 376 halten die Klausel für wirksam, wollen das Verhalten des Ver-
mieters aber als rechtsmißbräuchlich behandeln, wenn bei Rückgabe des Miet-
objektes die letzte Renovierung nur kurze Zeit zurückliegt).
c) Der erkennende Senat schließt sich der Rechtsprechung des
VIII. Zivilsenats für den Bereich der Geschäftsraummiete an.
Nach der gesetzlichen Regelung hat die Schönheitsreparaturen nicht der
Mieter, sondern der Vermieter vorzunehmen. Das folgt aus seiner Verpflichtung
in § 535 Abs. 1 Satz 1 BGB, das Mietobjekt während der gesamten Vertragszeit
in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten (Langenberg Schönheitsrepara-
turen Instandhaltung und Rückbau 2. Aufl. S. 22 Rdn. 1). Auch das Mietrechts-
reformgesetz hat daran nichts geändert (Haas Das neue Mietrecht - Mietrechts-
reformgesetz E 12, 63). Von diesem gesetzlichen Leitbild weicht die Vertrags-
praxis, insbesondere in Formularverträgen, seit langem ab. Auch der Bundes-
gerichtshof (Rechtsentscheid vom 30. Oktober 1984 - VIII ARZ 1/84 - WuM
1985, 46) hat es demgemäß gebilligt, daß in Formularverträgen Schönheitsre-
paraturen regelmäßig auf den Mieter verlagert werden dürfen, obwohl nach § 9
AGBG (jetzt: § 307 BGB) eine Bestimmung, die von wesentlichen Grundgedan-
ken der gesetzlichen Regelung abweicht, in der Regel als unangemessen und
damit unwirksam anzusehen ist. Begründet wird dies mit einer langen, bereits
Verkehrssitte gewordenen Übung (Langenberg aaO S. 24 Rdn. 6).
Die in Formularmietverträgen enthaltene Verpflichtung des Mieters, ne-
ben der Durchführung der Schönheitsreparaturen die Mietsache bei Beendi-
gung des Mietverhältnisses renoviert zurückzugeben, entfernt sich noch weiter
vom gesetzlichen Leitbild und führt zu einer zusätzlichen Verschärfung zu La-
sten des Mieters. Er muß in diesen Fällen eine Endrenovierung vornehmen un-
abhängig davon, wann die letzte Schönheitsreparatur erfolgt ist und ob ein Be-
darf hierfür besteht. Eine so weit gehende Abweichung vom gesetzlichen Leit-
bild hat der VIII. Zivilsenat nicht mehr mit § 307 BGB vereinbar angesehen
(BGH, Urteil vom 14. Mai 2003 aaO; Urteil vom 25. Juni 2003 aaO). Dem
schließt sich der Senat entgegen den von Wolf/Eckert/Ball (aaO Rdn. 377) vor-
gebrachten Bedenken auch für den Bereich der Geschäftsraummiete an. Der
Einwand, der VIII. Zivilsenat sei nicht auf den Aspekt eingegangen, daß die
Schönheitsreparatur Teil der Gegenleistung zur Gebrauchsgewährung sei und
die Überwälzung demgemäß in die Kalkulation der Miete eingehe, berücksich-
tigt nicht ausreichend, daß dem Mieter - abweichend von der gesetzlichen Re-
gelung - ein Übermaß an Renovierungspflichten auferlegt wird. Er muß die End-
renovierung unabhängig vom Zeitpunkt der letzten Schönheitsreparatur und
dem Zustand der Mietsache durchführen. Daß die vertragliche Äquivalenz ein-
schneidend gestört werden kann, wenn dem Vermieter zur Abgeltung der Ge-
brauchsgewährung nur die Mietzahlung verbleibt, hat sich der Vermieter selbst
zuzuschreiben. Wenn er dem Mieter ein Übermaß an Renovierungspflichten
auferlegt, trägt er das Risiko der Gesamtunwirksamkeit und kann sich nicht
darauf berufen, daß dadurch das vertragliche Gleichgewicht gestört wird.
Der Senat sieht keinen überzeugenden Grund, für den Bereich der Ge-
schäftsraummiete der Rechtsprechung des VIII. Zivilsenates nicht zu folgen.
aa) Zu Unrecht beruft sich das Berufungsgericht für die von ihm vertrete-
ne Auffassung auf den besonderen Schutz, den das BGB dem Wohnraummie-
ter gewährt. Zwar sieht das Gesetz für Teilbereiche einen besonderen Schutz
des Wohnraummieters vor. So ist z.B. der Kündigungsschutz des Wohnraum-
mieters stärker ausgeprägt (vgl. § 573 BGB). Ferner darf das Minderungsrecht
nicht zum Nachteil des Mieters beschränkt werden (§ 536 Abs. 4 BGB), worauf
das Berufungsgericht unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGHZ 127, 245) verweist. Für den Bereich der Schönheitsreparatu-
ren fehlt es aber an einer Besserstellung des Wohnraummieters. Nach der ge-
setzlichen Regelung des § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB schuldet der Vermieter von
Geschäftsräumen die Durchführung der Schönheitsreparaturen ebenso wie der
Wohnraumvermieter. Das Gesetz behandelt die Vermieter in beiden Fällen
gleich.
bb) Aus der vereinzelten Besserstellung des Wohnraummieters kann
nicht der Schluß gezogen werden, das Gesetz habe den Mieter von Geschäfts-
räumen generell weniger vor belastenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
schützen wollen. Zwar erlaubt das Gesetz eine weitergehende Beschränkung
der Rechte des Geschäftsraummieters (vgl. § 24 AGBG = § 310 BGB, wonach
die Klauselverbote der §§ 10, 11 AGBG = §§ 308, 309 BGB für Unternehmer
nicht gelten). Die Überwälzung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter ist
aber in den §§ 10, 11 AGBG nicht geregelt. Sie ist an § 9 AGBG zu messen,
einer Bestimmung, die für Unternehmer und Verbraucher gleichermaßen gilt.
cc) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann auch nicht
wegen einer allgemein geringeren Schutzbedürftigkeit des Geschäftsraummie-
ters von einer Vereinbarkeit der Klausel mit § 9 AGBG in Geschäftsraummiet-
verträgen ausgegangen werden. Zwar trifft es zu, daß der geschäftserfahrene
Unternehmer nicht in gleichem Maße schutzbedürftig ist wie ein Verbraucher.
Das kann z.B. der Fall sein, wenn der Unternehmer Geschäfte der betreffenden
Art häufig abschließt. Er kann deshalb mit den Risiken des Geschäfts vielfach
besser vertraut und dadurch zu einer entsprechenden Vorsorge in der Lage
sein (vgl. Palandt/Heinrichs BGB 64. Aufl. § 307 Rdn. 40). Für den hier betrof-
fenen Regelungsbereich gelten diese Überlegungen aber nicht. Geschäftsräu-
me werden regelmäßig langfristig vermietet. Die Problematik der Endrenovie-
rung stellt sich meist erst am Ende einer (langen) Vertragslaufzeit. Der Mieter,
insbesondere derjenige, der zum ersten Mal Geschäftsräume mietet, geht in der
Regel nicht davon aus, daß er - unabhängig vom Zeitpunkt der letzten Schön-
heitsreparatur - in jedem Fall eine Endrenovierung durchführen muß. Selbst
wenn er die Problematik erkennt, kann nicht ohne weiteres unterstellt werden,
daß ihm die örtliche Marktsituation die Abwehr einer solchen seine gesetzlichen
Rechte beschneidenden Klausel ermöglicht.
Auch der Hinweis, der Geschäftsraummieter könne die Kosten der End-
renovierung in die Preise für seine Waren und Dienstleistungen einkalkulieren,
überzeugt nicht. Zum einen ist bereits zweifelhaft, ob die jeweilige Marktsituati-
on eine solche Abwälzung erlaubt. Zum anderen ließe sich mit dieser Argumen-
tation jede für den Geschäftsraummieter nachteilige Klausel rechtfertigen. Dem
Mieter von Geschäftsräumen kann aber nicht zugemutet werden, die finanziel-
len Nachteile, die ihm durch eine seine gesetzlichen Rechte beschneidende
Klausel auferlegt werden, durch die mit geschäftlichen Risiken verbundene Er-
höhung seiner Preise aufzufangen. Daß in Einzelfällen ein Geschäftsraummie-
ter sich auf die Nachteile, die mit einer solchen Klausel verbunden sind, einzu-
stellen vermag, ist nicht entscheidend. Auch im Verkehr mit Unternehmern ist
nicht auf die Schutzbedürftigkeit im Einzelfall, sondern auf eine überindividuelle,
generalisierende Betrachtungsweise abzustellen (Palandt/Heinrichs aaO § 307
Rdn. 40).
dd) Der Senat hält es auch nicht für einen gangbaren Weg, von der Zu-
lässigkeit der Renovierungsklausel auszugehen und im Einzelfall die Berufung
auf eine unangemessene Benachteiligung gemäß § 242 BGB zuzulassen, wenn
die letzte Schönheitsreparatur erst kurz vor dem Auszug des Mieters liegt. Das
Gesetz sieht eine solche Differenzierung nicht vor. Nach der Regelung des § 9
AGBG sind unangemessene Klauseln unwirksam. Die §§ 9, 10, 11 AGBG
schließen in ihrem Anwendungsbereich als "leges speciales" den Rückgriff auf
§ 242 BGB aus (vgl. BGHZ 114, 338, 340; Staudinger/Coester BGB (1998) § 9
AGBG Rdn. 37 m.w.N.). Bei der Prüfung der Angemessenheit ist - wie ausge-
führt - nicht auf den Einzelfall abzustellen, sondern von einem generalisieren-
den objektiven Maßstab auszugehen. Das schließt es allerdings nicht aus, daß
die Berufung auf eine (wirksame) Klausel im Einzelfall treuwidrig sein kann (Pa-
landt/Heinrichs aaO Vorb. v. § 307 Rdn. 17).
ee) Der Senat hält auch eine Differenzierung danach, ob die Räumlich-
keiten dem Mieter renoviert oder unrenoviert überlassen worden sind, wie sie
Langenberg (aaO S. 34 Rdn. 28) vorschlägt, nicht für geboten. Auch der
VIII. Zivilsenat hat für den Bereich des Wohnraummietrechtes nicht darauf ab-
gestellt. Entscheidend ist vielmehr allein, daß der Mieter bei Beendigung des
Mietverhältnisses unabhängig vom Zeitpunkt der letzten Schönheitsreparatur
die Mietsache renoviert zu übergeben hätte. Es ist kein Grund ersichtlich, inso-
weit für die Geschäftsraummiete abweichend vom Wohnraummietrecht eine
weitere Unterscheidung vorzunehmen.
c) Damit kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben, soweit es der
Klägerin Schadensersatz wegen Unterlassung der Schönheitsreparaturen so-
wie eine Entschädigung wegen entgangener Nutzung in Höhe von insgesamt
11.526,33 € zugesprochen hat. Bei Unwirksamkeit der vorgenannten Klauseln
haben die Beklagten durch das Unterlassen der Schönheitsreparaturen und der
Endrenovierung keine ihnen obliegende Pflicht verletzt. Es muß daher insoweit
bei der klageabweisenden Entscheidung des Landgerichts verbleiben.
d) Soweit das Berufungsgericht die Beklagten zum Schadensersatz für
die Beseitigung eines Bretterverschlages und die Beschädigung des Fußbo-
dens in der Wohnung verurteilt hat, bleibt die Revision ohne Erfolg. Nach den
bindenden Feststellungen des Berufungsgerichts haben die Beklagten den
Bretterverschlag angebracht. Entgegen der Revision ist in den Tatsachenin-
stanzen kein ausreichender Vortrag gegeben, daß die Beklagten den von ihnen
angebrachten Verschlag nach Beendigung des Mietverhältnisses im Mietobjekt
zurücklassen durften. Ohne Erfolg berufen sich die Beklagten hilfsweise auf die
Verrechnung mit dem Kautionsguthaben. In den Tatsacheninstanzen hat die
Klägerin die Kaution lediglich gegen den Anspruch auf Nutzungsentschädigung
verrechnet. Hinsichtlich des Schadensersatzanspruches für den Fußboden hat
der Senat die Verfahrensrügen geprüft, im Ergebnis aber nicht für durchgreifend
erachtet (§ 564 ZPO).
Hahne Sprick Fuchs Ahlt Vézina



 Schnellkontakt
Schnellkontakt